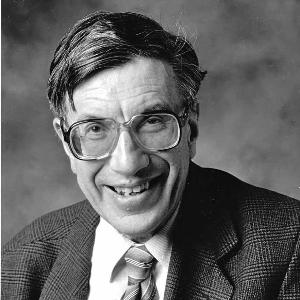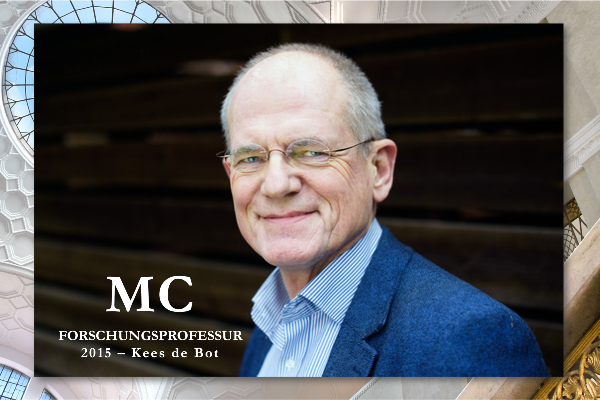Projektbeteiligte:
Dr. Marco Triulzi, Ludwig-Maximilians-Universität München
Dr. Stefanie Bredthauer, Universität zu Köln
Stefanie Helbert, Universiti Malaya
Mehrsprachigkeit prägt den Alltag vieler Menschen weltweit, sei es im familiären Umfeld, in sozialen Interaktionen oder beim Medienkonsum. Während bekannt ist, dass mehrsprachige Praktiken allgegenwärtig sind, ist noch weitgehend unbeleuchtet, inwiefern sich diese Praktiken im Hochschulkontext widerspiegeln. Der Umgang der Studierenden mit ihrer eigenen Mehrsprachigkeit und der Mehrsprachigkeit in der universitären Lehre, insbesondere im Sprachunterricht, ist noch wenig erforscht.
Das Projekt MultiVersity untersucht, wie Studierende weltweit mit Mehrsprachigkeit umgehen - sowohl in ihrem Alltag als auch im akademischen Kontext. Es wird untersucht, ob alltägliche Handlungen wie Musikhören oder Podcasten, Interaktionen mit Gleichaltrigen, der Konsum audiovisueller Medien, das Verfassen wissenschaftlicher Texte usw. international eher einsprachig oder eher mehrsprachig ausgeführt werden. Ebenso wichtig ist die Frage, welche Einstellungen sie zur Mehrsprachigkeit haben, sei es als persönliche Ressource oder als Teil ihres Sprachlernprozesses.
Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle von Mehrsprachigkeit im universitären Sprachunterricht. Wie erleben Studierende mehrsprachige Lehr- und Lernkontexte? Wie mehrsprachig oder einsprachig darf der Sprachunterricht sein? Und wie erleben sie es, wenn in einer Sprache unterrichtet wird, während andere Sprachen parallel verwendet werden?
Um möglichst viele Perspektiven einzufangen, wurde ein Fragebogen in eine Vielzahl von Sprachen übersetzt - darunter Arabisch, Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Malaiisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Tamil, Türkisch und Ukrainisch - und international verteilt.
Die Ergebnisse dieser Studie werden wertvolle Einblicke in die mehrsprachigen Praktiken und Einstellungen von Studierenden weltweit liefern. Dies kann dazu beitragen, die Lehrmethoden an Hochschulen weiterzuentwickeln und die Lehrpläne an die tatsächlichen sprachlichen Bedürfnisse und Potenziale der Studierenden anzupassen.